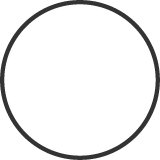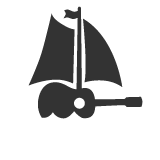Erwartungen sollten abgeschafft und verboten werden. Ich glaube mittlerweile fest daran, dass der Pessimismus der wahre Optimismus ist. Wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden und im Gegenteil: Alles wird im Endeffekt besser, als man es sich vorgestellt hat. Als ich damals auf die Salomonischen Inseln geflogen bin, habe ich mit dem Schlimmsten gerechnet und irgendwie war dann doch alles echt okay…
Ganz anders nun auf dem Weg von Französisch-Guyana nach Trinidad und Tobago. Der Wetterbericht sagt wunderbaren Wind aus der richtigen Richtung voraus. Außerdem fließt entlang der Nordküste von Südamerika die Guyana-Strömung, die uns schon auf dem Weg nach Cayenne mit bis zu vier Knoten dem Ziel deutlich schneller entgegengebracht hatte. Wir stellen uns also auf einen wahnsinnig schnellen Trip ein, auf dem wir die siebenhundert Seemeilen in weniger als einer Woche schaffen könnten. Doch erstens kommt alles anders und zweitens als man denkt.

Letztendlich brauchten wir fast doppelt so lange als geplant, haben die Hälfte der Zeit mit unseren Segeln geschimpft und unzählige Flüche gen Himmel geschickt. Zu wenig Wind, um die Segel zu füllen, aber zu viel, um sie komplett herunterzunehmen. Von dem ganzen Segelgeschlage ist dann auch noch unsere alte Fock gerissen, die wir zusammen mit der Genua am Vorstag als Passatsegel angeschlagen hatten…

Nach neun Tagen ist nun aber endlich Land in Sicht. Doch dann werden wir plötzlich von einer Gegenströmung erfasst, die uns bis zu vierzig Grad vom Kurs abweichen lässt. Frisches Gemüse und Obst ist schon längst aufgebraucht, wir wollten ja bereits da sein und die Dosenravioli werden auch nicht besser. Kalt oder warm macht keinen Unterschied mehr. So ist die Stimmung an Bord. Abschalten. Durchhalten. Am nächsten Tag sind wir immer noch auf der Nordseite von Trinidad und schaffen es gerade so nicht vor Einbruch der Dunkelheit den sogenannten „Drachenmund“ zu durchsegeln. Drei kleine Inseln, die nah beisammen liegen und enge Kanäle bilden, in denen zur falschen Zeit Strömung von bis zu fünf Knoten gegen dich arbeitet.

In den folgenden zweieinhalb Tagen versuchen wir wieder und wieder den Drachen zu besiegen, doch immer kurz vor dem Eingang geht uns der Wind aus und wir werden wieder zurückgetrieben. Eines Nachts unternimmt Benni mal wieder einen Versuch bei leichtem Wind im Schneckentempo in den Schlund zu schleichen, verschläft aber das Weckerklingeln, wir werden von einer Gegenströmung erfasst, der Autopilot beschwert sich nicht ob des falschen Kurses, Benni schreckt aber doch plötzlich auf, schaut auf das GPS, kann seinen Augen kaum trauen, blickt hinter sich und starrt im Dunkeln eine hundert Meter hohe Felswand hinauf, schafft es in der leichten Brise zu wenden und ruft dann mit zitternder Stimme nach mir, um das Boot erst mal wieder möglichst weit weg von dem Schrecken wegzumanövrieren. Drei Minuten später und wir wären gegen die Huevos Insel mit ihren steilen Klippen gesegelt!

Am nächsten Morgen schmeckt der Kaffee bitter, die Stimmung ist niedergeschlagen, ob wir das wohl jemals schaffen werden, die Ravioli sind alle und die T&T Fähre lacht uns nur höhnisch aus, als sie das zehnte Mal knapp an uns vorbei düst – von Trinidad nach Tobago und wieder zurück. Anstatt an Land Musiker aufzunehmen, unseren Motor reparieren zu lassen und irgendetwas zu schaffen, hängen wir hier auf Standby und lassen das Leben geduldig an uns vorbeiziehen, betäuben uns im stickigen Inneren von Marianne mit Filmklassikern á la „American Pie 6“, „Beerfest“ und „A good old fashioned Orgy“ – das deutsche Bier für neunundsiebzig Cent aus Cayenne hat es bis hier hin leider nicht geschafft.

Als am dritten Tag nach zwei weiteren erfolglosen Bändigungsversuchen des Drachens der alte Mann erneut die See mit seinem Fächer glatt gefegt hat, rufen wir per Satellitentelefon Deutschland an und bekommen eine Nummer vom Abschleppservice, der uns innerhalb von einer Stunde in die „Power Boats Marina“ zieht. Vielleicht liegt es an den Rostflecken am Rumpf, die der an Deck verstaute Anker hinterlassen hat, dass andere immer denken, sie könnten beim Docken unser Boot behandeln als wäre es aus Stahl und nicht aus Fiberglas – uns jedenfalls geht bei diesen Manövern der Arsch regelmäßig auf Grundeis, wenn wir gegen Stege, Pfeiler und andere Boote getrieben werden und mit letzter Kraft jegliche Gliedmaßen zwischen Marianne und Hindernis quetschen.

Irgendwie schaffen wir es in die Box, sind an Land und der Abschleppservice hätte gerne fünfhundert Dollar – US-Dollar wie sich am nächsten Tag herausstellen wird, nicht TT-Dollar – aber das wissen wir ein Glück noch nicht am ersten Tag, treffen sofort unabhängig voneinander zwei alte bekannte Seglerpärchen aus Madagaskar wieder, freunden uns mit dem Nachbarboot „Papagei“ an und verbringen mit dem Besitzer Axel aus Deutschland, der in Rostock den Papageien schon auf die Sandbank im Breitling gesetzt hat, einen rumlastigen ersten Abend.

In diesem Segler-Mekka mit hunderten Booten in Wasser und an Land haben wir mittlerweile schon die fünfte befreundete Crew getroffen, Jack Mantis – Rockstar und Freund von Andrew James aus Südafrika kennen gelernt, den deutschen Stammtisch entdeckt und indische Roti gegessen – das hätten wir nun wirklich nicht erwartet!